Das Freihandelsabkommen
Seite 1 von 1
 Das Freihandelsabkommen
Das Freihandelsabkommen
Ein Freihandelsabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag zur Gewährleistung des Freihandels zwischen den vertragsschließenden Staaten (beziehungsweise Völkerrechtssubjekten). Die Vertragspartner verzichten untereinander auf Handelshemmnisse, betreiben jedoch gegenüber Drittländern eine autonome Außenhandelspolitik. Es kann ein erster Schritt zu einer engeren wirtschaftlichen Integration zwischen Ländern sein.

Mercosur ist ein Beispiel für eine Freihandelszone zwischen den südlichen Lateinamerika Ländern.
Gegenstand von Freihandelsabkommen
Mit dem Abkommen wird der Freihandel im Bereich der Zoll- und Barrierefreiheit des Handels zwischen den Vertragspartnern gesichert. Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse (beispielsweise Einfuhrverbote oder Ausfuhrverbote sowie Einfuhrkontingente) werden abgeschafft. Gegebenenfalls verbieten Freihandelsabkommen auch andere staatliche Eingriffe wie Subventionen. In neueren Freihandelsabkommen sind oft auch Verträge über das Geistige Eigentum und Einschränkungen für staatliche Beteiligungen an Unternehmungen bzw. Wirtschaftssektoren enthalten.
Aus mehreren Freihandelsabkommen oder durch multilaterale Abkommen können Freihandelszonen entstehen. Freihandelsabkommen bzw. Freihandelszonen stellen die erste Stufe der wirtschaftlichen Integration dar, da anders als bei einer Zollunion die Vertragspartner einer reinen Freihandelszone ihre jeweiligen nationalen Zolltarife gegenüber Drittstaaten beibehalten. Zur Verhinderung von Verkehrs-, Produktionsverlagerungen und Wettbewerbsverfälschungen enthalten daher alle Freihandelsabkommen Ursprungsregeln, die sicherstellen, dass Waren präferenzberechtigt sind und damit zollfrei in den Vertragsstaat eingeführt werden können. Dies muss mit einem Präferenzpapier nachgewiesen werden. Wirtschaftliche Zusammenschlüsse auf einer höheren Integrationsstufe (Zollunion, Gemeinsamer Markt, Wirtschafts- und Währungsunion) sind jedoch immer auch Freihandelszonen.
Ziel von Freihandelsabkommen und Freihandelszonen
Ziel des Freihandelsabkommens beider Vertragspartner ist es, durch den Freihandel Vorteile bei der Güterverteilung und eine Steigerung des Außenhandels zu erreichen. Damit entsprechen sie dem Grundgedanken der (neo-)klassischen Außenhandelstheorie, die auf dem Modell der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo fußt, wonach durch freien Handel zwischen Staaten Wohlfahrtsgewinne für alle beteiligten Staaten erreicht werden können.
Die Welthandelsorganisation (WTO) fördert aus diesem Grund die Bildung von Freihandelszonen und den Abschluss von Freihandelsabkommen.
Entwicklungspolitische Bedeutung haben Freihandelsabkommen, die Entwicklungsländern den Zugang zu den Märkten der Industrieländer öffnen sollen; zu diesem Zweck führt die EU mit Staaten in Afrika, in der Karibik und im Pazifik Verhandlungen, die zum Abschluss von Freihandelsabkommen führen sollen (siehe Economic Partnership Agreement).
Die vollständige Liberalisierung des Welthandels würde nach einer Studie der Weltbank (2005) bis zum Jahr 2015 jährlich 250 Mrd. Euro an zusätzlichen Einkommen realisieren.
Kritik an Freihandelsabkommen
Gegen viele der Annahmen, mit denen Freihandelsabkommen begründet werden, richtet sich die Globalisierungskritik. Die tatsächliche Realisierung der Wohlfahrtsgewinne entsprechend dem Modell komparativer Kostenvorteile setzte demgemäß beispielsweise voraus, dass Produktionsfaktoren beliebig von einem Wirtschaftssektor in einen anderen verschoben werden können, was in der Realität oft vor allem kurzfristig nicht gegeben sei. Daher sei bei der Schaffung regionaler Freihandelszonen ebenso wie bei einer weltweiten Handelsliberalisierung immer die Frage, welche Länder und Personengruppen zumindest kurz- und mittelfristig zu den Gewinnern und Verlierern gehören.
Die Gewerkschaft Public Services International stellt für die 2010er Jahre eine ewig laufenden Maschinerie von Verhandlungen und Neuverhandlungen fest, die ein gemeinsames Ziel verfolge:
„Wer sich mit den neuen Handels- und Investitionsabkommen auseinandersetzen muss, die zurzeit verhandelt werden, kann in dem Buchstabendschungel schnell die Orientierung verlieren, muss er doch Kürzel wie TPP, TTIP, CETA, PA, TiSA usw. auseinanderhalten. Trotz dieser verwirrenden Liste mit Akronymen verfolgen all diese Verhandlungen im Kern ein vergleichbares, rein an unternehmerischen Interessen ausgerichtetes Programm. Jedes Abkommen bildet die Basis für das nächste Vertragswerk innerhalb einer ewig laufenden Maschinerie von Verhandlungen und Neuverhandlungen. Hart erkämpfte Ausnahmeregelungen, beispielsweise zum Schutz öffentlicher Dienste oder zur Ausklammerung von Regulierungen für Finanzdienstleistungen aus den Investitionsschutzvereinbarungen zwischen Staaten und Investoren, stehen in der nächsten Gesprächsrunde wieder zur Disposition. Darüber hinaus gilt für diese hektischen Verhandlungen weiterhin der Grundsatz der Geheimnistuerei und Verschleierung.“[1]
Beispiele
Typische Freihandelsabkommen liegen beispielsweise der NAFTA, der EFTA und dem EWR oder dem Mercosur zugrunde. Weitere Beispiele für Freihandelsabkommen sind:
EU–Korea FTA, neues Handelsabkommen seit 2010 mit einem geschätzten Wert von bis zu 19 Milliarden Euro durch die Aufhebung aller Zölle und vieler nichttarifärer Hemmnisse.
Gesamtamerikanische Freihandelszone (FTAA)
Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA)
Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), lateinamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft
Zentralamerikanischer gemeinsamer Markt (MCCA)
Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen (CEFTA)
Gemeinsamer Markt für das Östliche und Südliche Afrika (COMESA)
Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC)
Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)
Südasiatische Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (SAARC)
Freihandelszone des Verbandes Südostasiatischer Staaten (AFTA)
Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA)
New Zealand-China Free Trade Agreement
ASEAN-China-Freihandelsabkommen
Transpazifische strategische wirtschaftliche Partnerschaft (TPP, seit 2006)
Verhandelt aber nicht ratifizierte Freihandelsabkommen sind:
Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA)
Aktuell verhandelte Freihandelsabkommen sind:
Transatlantisches Freihandelsabkommen (TAFTA) seit Juli 2013: Verhandlungen zu einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)[2]
"FTA Japan EU"[3]
Aktuell geplante Freihandelsabkommen sind:
EU-Marokko-Freihandelsabkommen[4]
Weitere
Freihandelsabkommen der Europäischen Union
Quelle - literatur & Einzelnachweise

Mercosur ist ein Beispiel für eine Freihandelszone zwischen den südlichen Lateinamerika Ländern.
Gegenstand von Freihandelsabkommen
Mit dem Abkommen wird der Freihandel im Bereich der Zoll- und Barrierefreiheit des Handels zwischen den Vertragspartnern gesichert. Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse (beispielsweise Einfuhrverbote oder Ausfuhrverbote sowie Einfuhrkontingente) werden abgeschafft. Gegebenenfalls verbieten Freihandelsabkommen auch andere staatliche Eingriffe wie Subventionen. In neueren Freihandelsabkommen sind oft auch Verträge über das Geistige Eigentum und Einschränkungen für staatliche Beteiligungen an Unternehmungen bzw. Wirtschaftssektoren enthalten.
Aus mehreren Freihandelsabkommen oder durch multilaterale Abkommen können Freihandelszonen entstehen. Freihandelsabkommen bzw. Freihandelszonen stellen die erste Stufe der wirtschaftlichen Integration dar, da anders als bei einer Zollunion die Vertragspartner einer reinen Freihandelszone ihre jeweiligen nationalen Zolltarife gegenüber Drittstaaten beibehalten. Zur Verhinderung von Verkehrs-, Produktionsverlagerungen und Wettbewerbsverfälschungen enthalten daher alle Freihandelsabkommen Ursprungsregeln, die sicherstellen, dass Waren präferenzberechtigt sind und damit zollfrei in den Vertragsstaat eingeführt werden können. Dies muss mit einem Präferenzpapier nachgewiesen werden. Wirtschaftliche Zusammenschlüsse auf einer höheren Integrationsstufe (Zollunion, Gemeinsamer Markt, Wirtschafts- und Währungsunion) sind jedoch immer auch Freihandelszonen.
Ziel von Freihandelsabkommen und Freihandelszonen
Ziel des Freihandelsabkommens beider Vertragspartner ist es, durch den Freihandel Vorteile bei der Güterverteilung und eine Steigerung des Außenhandels zu erreichen. Damit entsprechen sie dem Grundgedanken der (neo-)klassischen Außenhandelstheorie, die auf dem Modell der komparativen Kostenvorteile von David Ricardo fußt, wonach durch freien Handel zwischen Staaten Wohlfahrtsgewinne für alle beteiligten Staaten erreicht werden können.
Die Welthandelsorganisation (WTO) fördert aus diesem Grund die Bildung von Freihandelszonen und den Abschluss von Freihandelsabkommen.
Entwicklungspolitische Bedeutung haben Freihandelsabkommen, die Entwicklungsländern den Zugang zu den Märkten der Industrieländer öffnen sollen; zu diesem Zweck führt die EU mit Staaten in Afrika, in der Karibik und im Pazifik Verhandlungen, die zum Abschluss von Freihandelsabkommen führen sollen (siehe Economic Partnership Agreement).
Die vollständige Liberalisierung des Welthandels würde nach einer Studie der Weltbank (2005) bis zum Jahr 2015 jährlich 250 Mrd. Euro an zusätzlichen Einkommen realisieren.
Kritik an Freihandelsabkommen
Gegen viele der Annahmen, mit denen Freihandelsabkommen begründet werden, richtet sich die Globalisierungskritik. Die tatsächliche Realisierung der Wohlfahrtsgewinne entsprechend dem Modell komparativer Kostenvorteile setzte demgemäß beispielsweise voraus, dass Produktionsfaktoren beliebig von einem Wirtschaftssektor in einen anderen verschoben werden können, was in der Realität oft vor allem kurzfristig nicht gegeben sei. Daher sei bei der Schaffung regionaler Freihandelszonen ebenso wie bei einer weltweiten Handelsliberalisierung immer die Frage, welche Länder und Personengruppen zumindest kurz- und mittelfristig zu den Gewinnern und Verlierern gehören.
Die Gewerkschaft Public Services International stellt für die 2010er Jahre eine ewig laufenden Maschinerie von Verhandlungen und Neuverhandlungen fest, die ein gemeinsames Ziel verfolge:
„Wer sich mit den neuen Handels- und Investitionsabkommen auseinandersetzen muss, die zurzeit verhandelt werden, kann in dem Buchstabendschungel schnell die Orientierung verlieren, muss er doch Kürzel wie TPP, TTIP, CETA, PA, TiSA usw. auseinanderhalten. Trotz dieser verwirrenden Liste mit Akronymen verfolgen all diese Verhandlungen im Kern ein vergleichbares, rein an unternehmerischen Interessen ausgerichtetes Programm. Jedes Abkommen bildet die Basis für das nächste Vertragswerk innerhalb einer ewig laufenden Maschinerie von Verhandlungen und Neuverhandlungen. Hart erkämpfte Ausnahmeregelungen, beispielsweise zum Schutz öffentlicher Dienste oder zur Ausklammerung von Regulierungen für Finanzdienstleistungen aus den Investitionsschutzvereinbarungen zwischen Staaten und Investoren, stehen in der nächsten Gesprächsrunde wieder zur Disposition. Darüber hinaus gilt für diese hektischen Verhandlungen weiterhin der Grundsatz der Geheimnistuerei und Verschleierung.“[1]
Beispiele
Typische Freihandelsabkommen liegen beispielsweise der NAFTA, der EFTA und dem EWR oder dem Mercosur zugrunde. Weitere Beispiele für Freihandelsabkommen sind:
EU–Korea FTA, neues Handelsabkommen seit 2010 mit einem geschätzten Wert von bis zu 19 Milliarden Euro durch die Aufhebung aller Zölle und vieler nichttarifärer Hemmnisse.
Gesamtamerikanische Freihandelszone (FTAA)
Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA)
Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), lateinamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft
Zentralamerikanischer gemeinsamer Markt (MCCA)
Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen (CEFTA)
Gemeinsamer Markt für das Östliche und Südliche Afrika (COMESA)
Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC)
Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)
Südasiatische Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (SAARC)
Freihandelszone des Verbandes Südostasiatischer Staaten (AFTA)
Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA)
New Zealand-China Free Trade Agreement
ASEAN-China-Freihandelsabkommen
Transpazifische strategische wirtschaftliche Partnerschaft (TPP, seit 2006)
Verhandelt aber nicht ratifizierte Freihandelsabkommen sind:
Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA)
Aktuell verhandelte Freihandelsabkommen sind:
Transatlantisches Freihandelsabkommen (TAFTA) seit Juli 2013: Verhandlungen zu einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)[2]
"FTA Japan EU"[3]
Aktuell geplante Freihandelsabkommen sind:
EU-Marokko-Freihandelsabkommen[4]
Weitere
Freihandelsabkommen der Europäischen Union
Quelle - literatur & Einzelnachweise

checker- Moderator
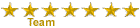
- Anzahl der Beiträge : 49390
Anmeldedatum : 03.04.11
Ort : Braunschweig
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten

» Einfach erklärt - Funktionsweiße, Fehlersuche und Tuning. Bürstenloser Nabenmotor
» Akne Filme Dr. Pimple Pooper
» R.I.P. Manni
» R.i.P. Manfred Wüstefeld
» R.I.P. Holger
» R.I.P Rudolf HAASE
» PAROOKAVILLE 2023 | Finch
» Festivalfilm - ROCKHARZ 2023